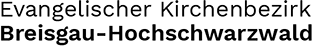Judika 29.03.2020 - Predigt von Pfr. i. R. Gerhard Jost
29.03.2020- Judika
12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor.13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13,12 - 14
Liebe Schwestern und Brüder,
als Kinder spielten wir früher gerne fangen. Das machte einen Riesenspaß, wenn man durch einen trickreichen Lauf dem Fänger endgültig entwischen konnte. Aber irgendwann klappte es mit der eigenen Puste oder der eigenen Kraft nicht mehr oder der andere war schneller, holte einen ein und man bekam einen Klaps auf den Rücken und man war draußen.
Draußen zu sein, das war schlimm, das war traurig. Denn während die anderen weiter rumtobten und spielten, stand unsereins da, zum Nichtstun verurteilt, musste warten bis die nächste Runde losging. Draußen, das haben wir als Kinder erlebt, das heißt ausgeschlossen sein, traurig sein, Einsamkeit. Deshalb geht Jesus, der ein Freund des Lebens war, nach draußen. Raus zu den Ausgegrenzten, zu denen, mit denen man keine Gemeinschaft mehr haben wollte. Zum Beispiel zu den Aussätzigen, die ja deshalb so hießen, weil man sie wegen ihrer Lepraerkrankung draußen vor die Stadttore brachte, abseits jeglicher menschlicher Behausung. Aber Jesus sah nicht auf die abfaulenden Gliedmaßen dieser Menschen, sondern auf ihre innere Traurigkeit und darauf, dass sie trotz aller Entstellung immer noch das von ihrem Vater geliebte Geschöpf sind. Jesus kannte sich draußen bestens aus. Er hat keinen fortgejagt. Er hat keinen nach draußen geschickt.
Nur einmal kommt es in der Bibel vor, dass er sagt, am Ende aller Zeiten, wenn sein Vater das letzte Urteil sprechen wird, dann werden einige draußen sein und nicht in Gottes neue Welt kommen. Nicht als Strafe, sondern weil sie es ein Leben lang weder gesucht noch gewollt haben. Denn Christus zwingt keinen Menschen zu Gott. In Gottes Reich gibt es nur Freiwillige. Wir haben also in Jesus einen Fachmann vor uns, der weiß, wie elend es Menschen geht, die draußen sind.
Nun sagt der Schreiber des Hebräerbriefs: am Ende seines irdischen Weges war Jesus wieder dort, wo er während der ganzen Zeit seines Missionsdienstes zu finden war, wieder draußen. Draußen vor den Toren der Stadtmauern Jerusalems. Denn in der Stadt durfte kein Mensch hingerichtet werden. Deshalb hatte man die Tötungsorte zur damaligen Zeit vor die Stadt gelegt, aber immer noch so nah bei ihr, dass es für die Gaffer nicht beschwerlich war, hinzukommen. Was da am 7. April des Jahres 30 auf Golgatha stattfand, das war nicht eine Hinrichtung, wie sie bei den Römern fast täglich in Israel vorkam.
Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: dieser Tod Jesu hat etwas mit dir persönlich zu tun. In allem Geschehen vom Karfreitag bist du gemeint. In der Sprache des Hebräerbriefs heißt das so: "Damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut." Das war schon immer die Absicht unseres Gottes, dass sein Volk heilig sein soll.
Bereits im dritten Buch Mose, Kapitel 19 im zweiten Vers ruft Gott seinem Volk zu: "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig." Heilig heißt aber nicht vollkommen, fehlerlos, moralisch einwandfrei, vorbildlich. Dieser katholische Heiligenbegriff ist der Bibel vollkommen fremd. Heilig ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff. Er meint, du Mensch sollst zu Gott in einer lebensvollen Beziehung stehen. Du hast dich, so wie du bist, nicht selber, sondern Gott, Gott will dich haben. Du bist nur dann richtig Mensch, wenn alle deine Lebensäußerungen auf ihn hinzielen oder von ihm herrühren. Und das sollte Israel leben. Aber sie taten es nicht. Und jetzt macht Jesus einen neuen Anlauf. Er gibt sich selbst hin, um zu zeigen, dass er mit seiner Liebe das Äußerste wagt, um Sie und mich zu erreichen. Er und ich, das soll eine ganz homogene, lebensvolle Einheit sein. Denn nur so gewinne ich meine Identität, meine Ganzheit und deshalb setzte er, nach dem Willen Gottes, sein Leben für mich ein. Das heißt, Sie und ich, wir sind von Gott geliebte Leute. Wir sind gefragt, wo ist denn dein Echo auf seine Liebe. Wo ist das Echo von Montag bis Sonntag?
Er ließ sich ausgrenzen, er ließ sich schlagen für mich, verhöhnen und verspotten, nur um eines zu erreichen: mich zu gewinnen. So viel bin ich ihm wert. So hoch schätzt er mich ein. So hoch schätzt mich kein Mensch ein und keine Institution der Welt.
Da schreibt ein zur lebenslanger Haft Verurteilter, der im Gefängnis durch die Begegnung mit dem Seelsorger eine Wandlung erfuhr: "Für die Gesellschaft bin ich ein Mörder, für Gott ein geliebtes Kind. Die Menschen sagen zu mir, dir kann keiner vergeben. Christus sagt: dir ist vergeben. Von ihm weiß ich mich geliebt."
Ja, es ist wahr, Jesus kann mit denen, die draußen sind, immer noch etwas anfangen. Weil er selber draußen war und weiß, wie es dort zugeht. Deshalb ruft dieser uns unbekannte Schreiber des Hebräerbriefs die Gemeinde auf: "So lasst uns nun zu ihm hinaus gehen". Dieser Mann hat offensichtlich etwas ganz Entscheidendes begriffen. Glaube ist Aufbruch, Bewegung, Unterwegs sein. Glaube ist kein Standpunkt, den man mühsam verteidigen müsste, so wie es bisweilen unsere Kirchenoberen tun. Sinnigerweise hat unsere Landeskirche das auch nicht begriffen. Die frühere Kirchenzeitung heißt "Aufbruch", die nächste Kirchenzeitung ab 1997 hieß "Standpunkte", - so ein Blödsinn.
Da ist das alles fest in starre Formen gegossen. Wenn Glaube lebendig ist, dann kann man so reden, wie Jesus. Er war voller Leben aus Gott. Er hat verstanden, dass es im Glauben keine Zuschauer geben kann. Entweder Nachfolge oder Leben ohne ihn. Dazwischen gibt es nichts.
Ich war vor vielen Jahren mit Jugendlichen in Colmar und wir uns haben den Isenheimer-Altar angeschaut. Wir hatten eine Museumsführerin engagiert, die den Jugendlichen dieses Bild ausführlich erklärte. Dann sagte diese Frau, eine etwas ältere Dame vor diesen jungen Leuten: "Es hat keinen Sinn, wenn ihr hier vor dem Bild steht und den Leidenden anschaut, oder euch Gedanken macht über die Kunst des Matthias Grünewald. Der Gekreuzigte muss euch selbst begegnen und in Bewegung versetzen, sonst ändert sich nichts." Diese wenige Worte schlugen bei den jungen Leuten ein wie eine Bombe. Erst kürzlich sagte mir einer der damals mitarbeitenden Jugendlichen, als ich ihn zufällig in Freiburg wiedertraf, an diesen Satz könne er sich noch erinnern, der hätte ihn sehr betroffen. Alles, was diese Frau sonst sagte, das war gar nicht mehr präsent, aber dieses.
Wer Christus begegnen möchte, kann nicht neutral bleiben, nicht Zuschauer bleiben. Wer seine Leidensgeschichte liest, liest sie nach dem Motto: da komme ich vor.
Gäbe es keine Corona-Pandemie würden in diesen Tagen wieder in verschiedenen Kirchen unseres Landes die großen Passionen von Johann Sebastian Bach oder die Werke von Schütz aufgeführt. Ob alle da hingehen würden, wenn es möglich wäre, , weil ihnen der Gekreuzigte so wichtig ist, oder weil sie nur ein Kunstgenuß wollen? Ob alle diese Töne nur gesungen würden, weil es Töne sind, oder weil man selber dahinter steht? Der Hebräerbrief sagt: "Lasst uns zu ihm hinausgehen." Ein solcher Aufbruch steht unter der Verheißung: Wer sucht, der findet! Ein Spaziergang ist der Weg zu und mit Jesus ganz gewiss nicht. Darum heißt es hier im Text: "und seine Schmach tragen". Wer sich auf Jesus einlässt, der darf nicht mit Bewunderung, mit Verehrung, mit Anerkennung rechnen. Schmach ist da etwas anderes. Das heißt Spott, Nachteile in Kauf nehmen, vielleicht gehänselt werden und in bestimmten Situation auch leiden. Nicht weil man masochistisch veranlagt ist, nicht weil man ungeschützt einfach drauflos schwätzt oder im falschen Augenblick vorprescht, sondern weil dies nach Jesu Worten zur Nachfolge zur Jüngerschaft ganz einfach dazu gehört.
Der erste Christ, der das in der Nachfolge Jesu erfahren hat, war Stephanus. So steht es in der Apostelgeschichte. Lesen Sie es einmal nach. Wer die Briefe des Paulus aufmerksam liest, der erfährt dort, durch was für schwere Stunden er gehen musste. Das ist es, was Jesus einmal sagte: "Siehe, ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe". Es mag sein, dass die Wölfe heute etwas zahmer geworden sind, so dass sich die Schafe in Sicherheit fühlen, aber das ist seit jeher der schlimmste Feind des Glaubens: das Sicherheitsdenken, die Gleichgültigkeit. Damit hat bereits die erste Christenheit schwer zu kämpfen gehabt. Wäre sie unterlegen, gäbe es heute keine Gottesdienste mehr, keine Diakonie, keine praktizierte Nächstenliebe.
Da ginge es noch viel, viel kälter in unserer Gesellschaft zu, als das bereits der Fall ist. Von einem Pfarrer, der in St. Petersburg arbeitet und der aus meiner früheren Jugendarbeit erwachsen ist, erhielt ich vor einiger Zeit einen sehr anschaulichen Bericht seiner Arbeit. Da schreibt er unter anderem folgendes: "Wo der Kommunismus seine Spuren gezeichnet hat, ist jeder sich selbst der Nächste. Solidarität, Vertrauen und innere Hörbereitschaft ist dort nicht zu finden, weil jeder im anderen den Feind wittert. Praktizierte Hilfsbereitschaft wirst Du bei den Christen finden. Da ist große Offenheit, sonst traurige Fehlanzeige".
Wenn der Schreiber des Hebräerbriefs die Christenheit und ihren Weg beschreiben will, und das tut er durch alle Kapitel hindurch, dann spricht er von dem wandernden Gottesvolk. Das macht auch der letzte Vers deutlich, den wir oft bei Beerdigungen zu hören bekommen: "Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir".
Das heißt, ihr Lieben, richtet euch auf dieser Erde nicht so ein, als würdet ihr hier für ewig bleiben können. Alles, wirklich alles müsst ihr mal zurücklassen. Auch das Haus, das du dir mühsam vom Munde abgespart hast, für das du alle Kräfte eingesetzt hast, vielleicht sogar bis an den Rand des Herzinfarkts. All' dein Eigentum ist Eigentum auf Zeit. Vergiss das nicht.
Vor einiger Zeit wurde ich Zeuge eines mehr als leidenschaftlichen Gespräches zweier Söhne, nachdem der letzte Elternteil verstorben war. Der eine konnte studieren, der andere nicht. Jetzt entbrannte vier Wochen nach dem Tod der Mutter ein riesiger Streit über die Aufteilung des Erbes, ob der, der studieren konnte, nicht viel mehr von den Eltern erhalten hätte, als der, der es nicht konnte. Dann dürfte das Erbe doch nicht halbiert werden, sondern gerecht wäre ein Verhältnis, so schlug der eine vor, siebzig zu dreißig, das wäre angemessen.
Ein langes Hin und Her, und ich saß dazwischen, ich habe eigentlich ganz etwas anderes dort gewollt, bis dass der eine unter lautem Gebrüll aufstand, seinen Bruder mit Schimpfworten bedachte und sagte: "Wir sehen uns vor Gericht wieder", und die Tür fiel ins Schloss.
"Wir haben hier keine bleibende Stadt." Hätten das die beiden begriffen, es hätte einen Weg zur Einigung gegeben. Was hat der eine davon, dass er mehr hat, aber darüber seinen Bruder verloren hat. Wer von den beiden kann denn auf ewig etwas festhalten und vermehren? Ich hab mich nach dieser Auseinandersetzung gefragt, woher es wohl kommt, dass wir Menschen immer meinen, wir würden über den Tisch gezogen, wir wären auf der Verliererstraße. Wer impft uns denn dieses ein?
Im Kinderzimmer kann man das schon erleben. Wenn Jesus sagt, er sei ein Freund der Zukurzgekommenen: Reicht das nicht, ihn als Freund zu haben? Den Besitz werden wir nicht in alle Ewigkeit haben, aber Jesus, der wird in alle Ewigkeit bei uns sein. Es erschreckt mich, wenn ich höre, dass in Deutschland in jeder Woche, wohlgemerkt in jeder Woche, mehr als eine viertel Milliarde Euro für Glückspiele ausgegeben werden. Warum setzen diese Leute so viel Geld jede Woche ein? Glauben die wirklich, dass Glück und Lebenssinn mit einem dicken Konto zusammenhängen?
Uns wird von einer bekannten Filmschauspielerin aus Hollywood berichtet, die, nachdem Mutter Teresa den Friedensnobelpreis bekommen hat, sie einmal besuchen wollte in den Slums von Indien. Als Mutter Teresa, eine Zeugin Jesu Christi, eine verwahrloste, schwerkranke Frau von ihrem Erbrochenen befreite und ihre Wunden liebevoll reinigte, da soll diese Filmschauspielerin sich ekelnd abgewandt haben und gesagt haben: "Das würde ich nicht für Hunderttausend Dollar machen". Schlagfertig antwortet Mutter Teresa: "Ich auch nicht".
"Wir haben keine bleibende Stadt" und können doch im Dienst für Christus glücklich sein. Da lebte im 19. Jahrhundert in den ärmlichen Dörfern in Polen ein bekannter Rabbiner. Zu ihm kam eines Tages ein Besucher und wollte irgendeinen Rat von diesem weisen Mann haben. Als der Mann in die Wohnung des Rabbiners eintrat, erschrak er. Ein einziges, winziges Zimmer. In dem Zimmer ein Tisch, eine Bank, ein Stuhl und viele Bücher. Dann fragte er den Rabbiner ganz verwundert: "Meister, wo haben sie denn ihre ganzen Möbel und den ganzen Hausrat?"
Der Rabbiner fragte zurück: "Wo haben sie denn ihre?" "Meine", sagte der Besucher ganz verblüfft, "ich bin doch nur auf Besuch hier. Ich bin nur auf der Durchreise." "Ich auch", antwortete der Rabbiner.
Amen.