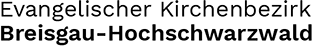Workshop Auftrag 3
„WORKSHOP 3“
12.03.25 – 19-21.30 h Kirchzarten
„Modelle für die Kirche der Zukunft”
Vorbereitung:
Stuhlkreis
Gesangbücher NL
Material:
Namensschilder
Moderationskoffer
Kopie Bibeltext und Beschreibung der Modelle
Flipchartpapier – Dekanat
Pinnwände: Gemeinde
Catering: Gemeinde
Ablauf:
19.00
Einstieg
Begrüßung & Vorstellungsrunde
Lied: Aus den Dörfern und aus Städten (NL 2)
19.15
Einführung, Prozessbeschreibung und inhaltlicher Bogen zu bisherigen Workshops
Workshopergebnisse auf ekbh.de
19.30
Bibelarbeit
Textgrundlage: 1. Thess. 5,16-25
Satzanfang auf Flipchart: „Kirche der Zukunft braucht …“
Welche Impulse für die Gestaltung der Kirche der Zukunft leiten wir aus dem Bibeltext ab? Bitte übertragen Sie diese in unsere Zeit!“
Jede Gruppe schreibt 3-4 Impulse für die Kirche der Zukunft auf Grundlage des Bibeltextes auf Karten.
19.35
Austausch der Ergebnisse
Vortragen der Ergebniskarten, Anpinnen auf Pinnwand
19.45
PAUSE
20.00
4 mögliche Modelle der Kirche, aktuell und in der Zukunft
Jede Gruppe erhält Beschreibung nach Uta Pohl-Patalong.
Aufgabe: Wir werben für unser Modell!
Wesentliches auf Flipchart schreiben, in Gruppen Darstellungsart überlegen (Stichworte vortragen, Szene spielen, Text schreiben
20.30
Präsentation der Ergebnisse
20.45
Sammeln von Schwächen der einzelnen Modelle (Karten)
21.00
Abschluss
Welcher Aspekt der 4 Modelle passt zu dem., was wir aus dem Bibeltext 1. Thess. 5 als Impulse für die Kirche der Zukunft erkannt haben? Bitte schreiben Sie Gedanken auf Karten und tragen diese danach vor.
21.15
Feedback, Ausblick auf weiteren Prozess,
Dank und Segen
Modelle einer zukünftigen Gestalt von Kirche (nach Uta Pohl-Patalong, Kirche gestalten. Wie die Zukunft gelingen kann, 2021, Seite 137 ff.)
Modell 1: Kirche als Ortsgemeinde
Die klassische Ortsgemeinde soll nach diesem Modell noch viel stärker als bisher als die wichtigste kirchliche Gestalt von Kirche etabliert werden.
Es geht um die „Kirche der Kontinuität“, in der christliches Leben regelmäßig und verlässlich eingeübt wird. Dafür bietet die Ortsgemeinde die größten Chancen. Sie ermöglicht persönliche Beziehungen und soziale Kontakte, die den christlichen Glauben unterstützen. Die Ortsgemeinde vermittelt Vertrauen zur Kirche und zu den Personen, die in ihr tätig sind. Zu ihnen werden langfristige Beziehungen aufgebaut, die möglichst über Generationen hinweg bestehen. Durch ihre Orientierung am Wohnort verbindet die Ortsgemeinde verschiedene Milieus und lässt Menschen einander begegnen, die sich im Alltag nur selten sehen. Die Kerngemeinde soll aufgewertet werden. Gleichzeitig sollen Kirchenmitglieder, die bisher nicht aktiv sind, durch theologisch gehaltvolle Predigten und ansprechende Angebote in die Ortsgemeinde integriert werden.
Hauptamtliche sind zentrale Akteur*innen, die sich in der Gemeinde und unter deren Mitgliedern am besten auskennen. Der Pfarrberuf ist bewusst sehr offen ausgerichtet. Seine Arbeit soll durch die Ehrenamtlichen ergänzt werden.
Das Modell wendet sich gegen eine Profilbildung von einzelnen Gemeinden und eine Spezialisierung kirchlicher Arbeit. Schwerpunktbildungen sind nicht ausgeschlossen, aber sie sollen von den persönlichen Begabungen der Hauptamtlichen abhängen und nicht in ein bleibendes Konzept gegossen werden. Keinesfalls soll sich die Gemeinde an Zielgruppen orientieren.
Eine Stärke des Modells kann darin gesehen werden, dass es vertraut ist.
Eine Schwäche ist, dass nicht deutlich wird, wie die notwendigen Reformen der Kirche, hervorgerufen durch Mitgliederschwund und weniger hauptamtliches Personal, damit angegangen werden können. Zudem spricht die Ortsgemeinde immer nur einen bestimmten Personenkreis in der Kerngemeinde an.
Modell 2: Kirche in der größeren Region
Regionalisierung ist ein Sammelbegriff, unter dem sich Unterschiedliches verstehen lässt. Es kann sich auf eine große Region wie einen Kirchenbezirk oder auf die Zusammenarbeit von zwei Ortsgemeinden oder einen Kooperationsraum beziehen. Die gemeinsame Arbeit kann stärker oder schwächer ausfallen. Meist wird jedoch wenigstens ein Arbeitsbereich dauerhaft in der Region oder von einer Gemeinde für die Region übernommen, z.B. die Jugendarbeit. Regionalisierung kann ein gemeinsames Gottesdienstkonzept umfassen. Auch können z.B. Kirchenmusiker*innen für mehrere Gemeinden zuständig sein. Das kann zu unterschiedlichen Rechtsformen führen wie die Gründung eines Gemeindeverbandes oder eine Zusammenlegung der bisherigen Gemeinden zu einer neuen großen Kirchengemeinde, eine Fusion. Auch können kirchliche Präsenzen wie das Diakonische Werk, das Jugendwerk oder eine Arbeitsstelle für die bessere Verbreitung von Taufen und Hochzeiten in einer Region oder im Kirchenbezirk angesiedelt werden.
Ortsgemeinden werden durch übergemeindliche Zusammenarbeit ergänzt. Die Menschen werden ermutigt, an den Angeboten einer Gemeinde ihrer Wahl in der Region (in Baden: im Kooperationsraum/Kirchenbezirk) teilzunehmen oder die übergemeindlichen Angebote zu besuchen.
Diakon*innen und Pfarrer*innen sowie Kirchenmusiker*innen arbeiten in Teams zusammen. Sie können sich spezialisieren und das machen, was sie am besten können. Teambildung wird gefördert.
Die Regionalisierung kann dazu beitragen, Gruppen/Kreise/Veranstaltungen, die für eine einzelne Gemeinde zu teuer sind, im Kooperationsraum oder im Kirchenbezirk anzubieten. Sie sollte inhaltlich motiviert sein. Die Kirchenmusik oder die Diakonie können in der Region gestärkt werden.
Eine Stärke der Regionalisierung ist ihr Pragmatismus: Das Modell geht von den gegenwärtigen Gemeinden aus und führt sie hinein in eine größere, regionale Einheit. Menschen in der Region finden leichter ein für sie passendes Angebot als nur in der Ortsgemeinde. Neue Angebote können in der Region entwickelt und von einem Team für den ganzen Kooperationsraum/Kirchenbezirk umgesetzt werden.
Eine Schwäche des Modells besteht darin, dass es an den Einzelinteressen der bestehenden Gemeinden scheitern kann.
Modell 3: „Kirchliche Orte“
Das Modell setzt bei der Frage an, welche Stärken die Ortsgemeinden und welche die „nichtparochialen Arbeitsformen“ (Diakonie, Erwachsenenbildung …) haben. Es sucht einen dritten Weg, um die Stärken beider Formen von Kirche zu verbinden. Das Modell setzt an bei den Orten, an denen kirchliche Arbeit stattfindet: Kirchen, Gemeindehäuser, Kitas, kirchlich genutzte Räume in Kliniken oder Pflegeheimen, Akademien oder Citykirchencafés. Das Gegenüber der Ortsgemeinde und der nichtparochialen Formen von Kirche wird aufgehoben. Alles sind „kirchliche Orte“ und haben dieselbe Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben in Wort und Tat, es zu kommunizieren. Sie tun das auf ihre Weise. An jedem kirchlichen Ort soll es zwei Bereiche kirchlicher Arbeit geben: einerseits inhaltlich definierte Arbeitsbereiche, die kirchliche Angebote für eine Region/einen Kooperationsraum übernehmen, und andererseits ein an den Interessen und Themen der Menschen orientiertes kirchliches Leben vor Ort. Das soll von Gemeinschaft und Geselligkeit bestimmt sein.
Der erste, inhaltliche Bereich gestaltet bestimmte Handlungsfelder für einen größeren Raum, z.B. Erwachsenenbildung, diakonische Arbeit, Seelsorge in der Klinik, Kirchenmusik … Dabei sollte ein Ort nicht nur einen, sondern mehrere Bereiche übernehmen. In diesem inhaltlichen Feld sind sowohl Ehrenamtliche als auch Hauptamtliche verschiedener Berufsgruppen tätig. Besonders für den Pfarrberuf bedeutet das im Vergleich zur derzeitigen Ortsgemeinde eine Spezialisierung: Pfarrer*innen sind dann neben Gottesdiensten und Taufen/Hochzeiten/Trauerfeiern für zwei, drei bestimmte Arbeitsgebiete zuständig, die den kirchlichen Ort prägen, an dem sie tätig sind. Welcher kirchliche Ort welche Arbeitsbereiche übernimmt, sollte in einem längeren inhaltlichen Prozess entwickelt werden.
Der zweite Bereich an einem kirchlichen Ort ist von Gemeinschaft und Geselligkeit bestimmt. Ihm entsprechen traditionelle Angebote wie Seniorenkreise, Bibelkreise, Gemeindefeste … Diese Angebote kommen Menschen zugute, die vor Ort Gemeinschaft suchen. Was genau angeboten werden soll, richtet sich nach den Bedürfnissen der Menschen z.B. im Dorf. Dieser Bereich wird nicht von Hauptamtlichen für andere organisiert, sondern mit hauptamtlicher Unterstützung von Ehrenamtlichen.
Modell 4: Fresh Expressions of Church
Dieses Modell nimmt Ideen aus der anglikanischen Kirche in England auf. Dort gibt es schon lange keine flächendeckende kirchliche Versorgung mehr. Es knüpft dabei an die Überlegungen zu „missionarischen Gemeinden“ aus den 1980-er-Jahren an. Die Fresh Expressions of Church gehen aus von der Beobachtung, dass immer mehr Menschen noch nie Kontakt zur Kirche hatten. Darum sollten die kirchlichen Strukturen nicht länger einseitig auf die Bewahrung der Tradition ausgerichtet sein, sondern sie müssen überzeugend zu einer Erstbegegnung mit dem Evangelium einladen. Die „Fresh X“ sind Neugründungen von Gemeinden in vielfältigen Formen, die flexibel auf die Menschen und ihre Themen in den jeweiligen Kontexten eingehen. Sie haben keine festgelegte Gestalt, sondern entwickeln sich in unterschiedlicher Weise. Es sind Gemeinden in Schulen, Cafes, an Surfstränden oder in Plattenbauten. Die neuen Formen bilden keine „Brücken“ in die bisherigen Gemeindestrukturen, sondern sind jeweils eigene Gemeinden im Vollsinn. Leitend soll die Präsenz Christi unter den Menschen sein, erst anschließend folgt die Gemeindebildung. In diesen Gemeinden ist die Gemeinschaft besonders wichtig. Mit ihrem diakonischen Charakter sind sie oft am Sozialraum orientiert. Sie möchten darauf reagieren, was Menschen im jeweiligen Umfeld brauchen.
Die „Fresh X“ sollen die Ortsgemeinden nicht ersetzen, die für manche Menschen sinnvoll bleiben, sondern in einer guten Mischung neben sie treten. Die Hauptamtlichen bekommen in diesem missionarisch ausgerichteten Modell von Kirche eine veränderte Rolle zugewiesen. Sie sind nicht mehr diejenigen, die in erster Linie die Gemeindearbeit durchführen, sondern die fördern und begleiten Teams, die je nach ihren Charismen missionarisch tätig sind.
Eine Stärke der Modells ist, dass es die Kirche motiviert, sich wirklich auf die Lebenswelten der Menschen einzulassen.
Als Schwäche wäre zu nennen, dass Christsein und Kirchenmitgliedschaft auf die aktive Beteiligung an den jeweiligen kirchlichen Formen beschränkt ist. Die Vielfalt von Wegen, Kirchenmitglied zu sein und auch sporadisch oder projektartig an kirchlichen Angeboten teilzuhaben, wird aufgelöst in die auf aktivem Engagement beruhende Einbindung in die Gemeinde. Zudem ist unklar, wie sich die neuen Strukturen verstetigen können.
Merkmale einer "Kirche der Zukunft" auf dem Hintergrund des Bibelgesprächs zu 1. Thess. 5:
Kirche der Zukunft braucht eine Sprache, die die Menschen erreicht.
Kirche der Zukunft braucht Menschen, die ihren Glauben enthusiastisch leben.
Kirche der Zukunft braucht Menschen, die beten.
Offenheit (ohne Beliebigkeit)
Andere Formen
Miteinander
Gemeinschaft
Zuversicht
Authentizität
Gebet
Dankbarkeit
Vielfalt
Wertschätzung
Einladend
Zuwendung
Fröhlichkeit
Be-„Geist“-erung
Stichworte aus der Diskussion über die verschiedenen Modelle der Kirche der Zukunft
Stärken der Ortsgemeinde:
Zu Gast bei Freunden mit Freunden
Unterwegs sein mit Anderen
Reden über Gott
Vernetzt sein mit Evangelium
Mission
Basis leben gemeinsam
Mut zum Miteinander mit Freunden
Langfristige Beziehung
Kontinuität
Verbindlichkeit Zeitgeist
Räumliche Nähe
Soziale Nähe
Menschliche Beziehungen
Befriedigung von Bedürfnissen
Identifikationsperson (Pfarrerin/Pfarrer)
Stärken der Arbeit als Kooperationsraum und im Modell "Kirchliche Orte":
Gegenseitige „Befruchtung“ der einzelnen Gemeinden
Ausweitung der „Gemeindeglieder“
Sichtbare Ausweitung der kirchlichen Angebote
Vielfalt der Gottesdienstformen und anderer Angebote
Nutzung von Synergien
Ehrenamt stark machen
100Prozent-Stelle Kirchenmusik
Stärken der Fresh X - Bewegung:
Fresh-Ex: Einzelne Arbeit eher kurzfristig, Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft schwierig
Zusammenfassung
Wir müssen als KIrche in jeder Form begeisternd sein.
Die Fragen der der Form sind geistliche Fragen.
Wir sollten auf biblische Faktoren für Wachstum achten (s. Bibeltext).
Wie kann die Institution das Wachstum fördern?
Kriterien:
Was ist mitreißend? Was ist milieuübergreifend? Was sorgt für Gabenorientierung? Was zeigt unsere Vielfalt im Kooperationsraum/Bezirk?